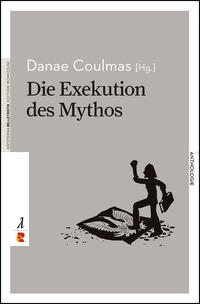Giorgos A. Mangakis: Freiheit, meine Geliebte
Giorgos Alexandros Mangakis (1922–2011), geboren in Athen, studierte Jura in Athen und München und war Professor für Strafrecht an den Universitäten von Athen und Freiburg. Als Mitglied des organisierten Widerstands gegen die Diktatur wurde er 1969 vom Dienst suspendiert, 1970 zu 18 Jahren Haft verurteilt. 1972 wurde er aus gesundheitlichen Gründen entlassen; nach Bemühungen der Regierung Brandt reiste er in die BRD aus und arbeitete dort als Gastprofessor an der Universität Heidelberg. 1974 kehrte er nach Griechenland zurück, 1982–1986 diente er als Justizminister. 1973 verfasste er Freiheit, meine Geliebte [Ελευθερία, αγάπη μου], einen Essay, der, herausgeschmuggelt aus dem Gefängnis und in mehrere Sprachen übersetzt, zu einem Dokument des europäischen Denkens wurde. Die Edition Romiosini/CeMoG präsentiert diesen Text aus Danae Coulmas (Hg.), Die Exekution des Mythos. Eine Anthologie mit Texten des Widerstands aus der Zeit der griechischen Militärdiktatur 1967–1974, Berlin, Edition Romiosini, 2017, S. 263-283.
Freiheit, meine Geliebte (1973)
Ich nehme diese zerknüllten Papiere aus ihren Verstecken heraus und lese sie. Unter den Bedingungen, unter denen sie beschrieben und vor meinen Wächtern geheimgehalten worden sind, stellen sie irgendwie die Rettung meiner Unabhängigkeit dar und sind mir schon als Gegenstand, als Papier teuer. Ich habe darauf geschrieben in Stunden, in denen ich die angstvolle Beklemmung der Haft durch das Schreiben zu überwinden versuchte. So sind sie weder eine bloße Niederschrift von Überlegungen, noch sind sie natürlich Briefe. Sie sind unzertrennlicher Teil dieser Angst in der Haft. Und dennoch, ich habe sie nicht nur für mich allein geschrieben, so dürftig sie auch sein mögen. Zum Gefühl der Angst im Gefangensein gehört neben vielem anderen auch das tiefe Bedürfnis nach Kommunikation. Es gibt Augenblicke, in denen man an diesem Bedürfnis beinahe erstickt. Jetzt weiß ich, warum die Schiffbrüchigen auf öden Inseln ihre Botschaften dem Meer in Flaschenpost anvertrauen. Diese Papiere hier sind etwas Ähnliches. Ich fühle mich nicht als schiffbrüchig, ich habe mit Sicherheit keinen Schiffbruch erlitten. Doch verspüre ich die gleiche verzweifelte Sehnsucht nach Kommunikation. Und davon erstatte ich hier Bericht. Ich weiß sogar, für wen diese Aufzeichnungen geschrieben sind. Welche Menschen sie erreichen wollen. Diejenigen, die die Tragödie meines Landes zwar selbst nicht erleben, aber im Stande sind sie zu begreifen. An solche Menschen ist stets eine Flaschenpost gerichtet worden. Die Haft ist eine Krise, in der einiges von selbst klar wird. Zum Beispiel die Gewissheit, dass die Freunde überall in Europa, an die ich hier so oft denke, auch an mich denken. Weil wir die gleiche menschliche Sprache sprechen und uns in ihr verstehen. Es gibt natürlich auch woanders auf der Welt viele Freunde, aber mir sind die in Europa selbstverständlich näher. Und dennoch: Uns trennt der Stacheldraht, der in meinem Land die Menschlichkeit unerbittlich umschließt. Es ist, als stünden sie auf dem Festland und wir trieben weg, fortgetragen von einem finsteren Strom.
So ist es allzu natürlich, wenn dieses Zeichen von mir, dieser Wink an sie gerichtet ist. An Freunde, die ich gekannt habe, und an solche, denen ich nie begegnet bin, wende ich mich; mit diesem Zeichen, das beinah nichts bedeutet und natürlich auch nichts verlangt, das aber mir das nicht mehr so selbstverständliche Gefühl gibt, dass es mich noch gibt; und dass sie noch in meiner Nähe sind. Noch können unsere Blicke einander erreichen.
Ich wehre mich. Deswegen schreibe ich. Auf diese Weise behalte ich meinen Verstand auf meiner Seite. Wenn man ihn der Stütze niedergeschriebener Gedankengänge beraubt, gerät er außer sich. Er folgt seltsamen Wegen, schließlich gebiert er Ungeheuer und so tritt er auf die Seite des Wächters über. Das ist es gerade, was sie mit der Haft bezwecken. Sie sperren dich in einem Raum ein, drei Schritte vorwärts, drei zurück. Und du gehst hin und her, ununterbrochen, stundenlang, tagelang. Am Anfang hast du deinen Verstand bei dir, an deiner Seite. Ihr unterhaltet euch, dir wird dadurch manches klar. Du kannst sie erkennen, die dir zuträglichen Ideen. Du erfasst das Böse in äußerster Klarsicht. Das, was den Menschen erniedrigt. Du siehst dich in deinem Recht bestätigt und darum stark. Du wirst sie ertragen, meinst du, die Haft. Du existierst in dieser Zelle, um die ideelle Substanz des Menschen zu verteidigen. Ungefähr wie jene in der Schlacht zerfetzten Fahnen, die, noch hoch oben auf ihre Stange gehisst, auch dann ihre Funktion erfüllen. Aber wie willst du ewig weiter hin- und hergehen, drei Schritte vor, drei zurück, dich mit dir selbst freundlich unterhaltend, mitten in einer entleerten Zeit? Das geht nicht. Diese Schritte knüpfen langsam um dich das Netz des Taumels. Du kannst dich nicht unaufhörlich mit deinem eigenen Verstand unterhalten. Diese zunächst selbstverständliche Entzweiung deines Ichs droht mit der Zeit, dir die Sinne zu spalten. Wenn wir mit unseren eigenen Gedanken in Eintracht sein wollen, brauchen wir auch die Gedanken des anderen. Und wir brauchen auch die gedankenlose Zeit. Während du so hin- und hergehst, zusammen mit deinem Verstand, wird er allmählich dir gegenüber heimtückisch: Er meldet dir merkwürdige, doch durchaus diskutable Widersprüche an. Das ist es. Das ist die Absicht der Haft: Dass du so weit kommst, Dinge, die wider die Vernunft sind mit dir selbst zu diskutieren. So beginnt man sich von der eigenen Position zu entfernen und gerät unwillkürlich in einen Strudel, der einen mit der Zeit immer stärker mitreißt und ganz zu entwurzeln droht. Hier setzt die Spaltung an, die dich am Ende zum Feind deiner selbst verwandeln wird. Du und dein Verstand, ihr werdet zu zwei Feinden, eingeschlossen in den winzigen Raum der Zelle, mitten im Chaos der Zeit. Das sich gegenseitige Zerfleischen ist unvermeidbar. Du ringst mit einer entfesselten Furie, die deine Überzeugungen angreift. Genau die Überzeugungen, durch die du, solange du noch in ihrem Besitz bist, dich rettest; durch die du noch Mensch bleibst. Verlierst du sie, bist du wie eine leere Schale. Es ist mit dir vorbei. Wäre nicht auch dann die angstvolle Beklemmung, so würde ich sagen, du wirst ein Mensch a.D. Das bezweckt die Haft: Dass du als Mensch nur noch aus Angst und Verzweiflung bestehst. Sonst nichts. Und diese Aufgabe wird deinem Verstand aufgetragen, mit dem man dich zusammen für all die unausweichlich gleichförmigen, leeren Tage deiner Gefangenschaft einsperrt. Sie verwandelt deinen einzigen Genossen zu einem entfesselten Gegner. Und du wirst zu einem Monster: Zwei siamesische Zwillinge, die sich tödlich hassen. Das ist der Alptraum des Tages.
Ich bekämpfe ihn durch das Schreiben. Das ist meine einzige Waffe, so erhalte ich noch die Ausmaße einer richtigen Gestalt: Ich bin jemand mit zwei Armen, zwei Beinen, einem Kopf. Mit einem Verstand. Ich bleibe weiterhin meiner gleichen gleich. Wenn die Hersteller des Papiers und der Bleistifte wüssten, wie dankbar ihnen die Gefangenen sind. Ich stelle mir ihre Finger, Finger von Menschen bei der Arbeit vor und meine Augen füllen sich mit Tränen. Sie geben mir die einzige Möglichkeit, als Mensch meine aufrechte Haltung zu wahren, nicht zu dem herabzukommen, was die Haft aus mir machen will; sie geben mir die Möglichkeit, mich zu retten. Wenn ich schreibe, bin ich nicht gefangen. Ich bändige meinen Geist, als meinen Genossen, und lebe mit ihm in der Welt der einfachen Bedeutungen. Auch ich lebe irgendwie wie ein Mensch.
Ich sollte meinen Raum beschreiben. Denn er bedingt den Zustand meiner Seele und ist eins der Grundelemente meines jetzigen Daseins. Man ist vielleicht sogar imstande, sich an diesen Raum langsam zu gewöhnen, ihn vielleicht sogar zu mögen; er ist ja das Loch, in das du dich verkriechst und deine Wunden leckst. Im Grunde aber ist er Mittel zu deiner Vernichtung.
Es ist eine Zelle, etwa 3 mal 3 Meter. An der einen Seite wird sie durch eine schwere eiserne Tür geschlossen. Diese hat in der Mitte eine kleine runde Öffnung. Die Gefangenen verabscheuen sie und nennen sie Spion. Denn dort erscheint immer wieder das Auge des Wächters. Du siehst nur ein Auge, kein Gesicht. Eigentlich siehst du eine Tür aus Eisen mit einem lebendigen kalten Auge in der Mitte. Die Tür ist wie ein Zyklop. Sie hat auch ein eigenartiges Schloss, das nur von außen zu bedienen ist. Das macht ein doppeltes, trockenes Geräusch, an das man sich nie gewöhnen kann, mögen auch noch so viele Jahre vergehen. Es ist die alltägliche, durch die Sinne fassbare Gewalt. Ich wusste vorher nicht, dass Gewalt sich so einfach darstellen könnte, durch ein doppeltes, trockenes, metallisches Geräusch.
An der anderen Seite ist ein kleines, vergittertes Fenster, durch das man einen Teil der Stadt sehen kann. Die Gefangenen gucken aber selten hinaus. Denn das ist zu schmerzhaft. Durch den Blick nach außen wird das Leben jenseits der Gefängnismauer real. Das tut weh. Der Gefangene trägt zwar das Bild des Lebens draußen tief in sich selbst, aber es ist ein vergilbtes, verschwommenes Bild, wie ein Schwarz-Weiß-Foto aus alten Zeiten. Farblos, gewichtlos, sanft; man kann es ertragen. Aber aus dem Fenster schauen, wie sollte man es … Das Fenster ist nur wegen des Lichtes da. Das Licht habe ich ausgiebig studiert. Ich kenne seine Tausenden von Nuancen. Ich merke das Licht, das vor der Morgendämmerung aufkommt, und auch das Licht, das noch ein wenig in die Nacht hinein leuchtet. Das Licht ist die Freude des Gefangenen, denn oft trifft eine seiner Nuancen auf sein seelisches Bedürfnis. Es hat Augenblicke gegeben, wo ich zum Licht schauend gesungen habe, und andere wiederum, in denen ich traurig in ihm Trost fand. Soviel über das Fenster.
In meiner Zelle gibt es außer der Eisentür und dem Fenster auch die Temperatur. Ein weiterer Bestandteil meiner Existenz. Im Winter ist es unerträglich kalt, im Sommer unerträglich heiß. Das empfinde ich als ganz normal, obwohl mich beides quält, beides ein Symptom ist für das Ausgeliefertsein, welches die Haft für den Menschen bedeutet. In einer solchen Lage ist nichts anderes möglich, man muss unmittelbar in der natürlichen Temperatur der Welt leben.
In diesem Raum verbringe ich endlose Stunden, am Tag, in der Nacht. Wie an einem Faden hängen die Tage und die Nächte meines Lebens tot aufgefädelt. Dieser Raum ist ein Kampfring. Hier ringt ein Mensch ganz allein gegen das Böse dieser Welt.
Ich schreibe und verstecke meine Papiere. Schreiben ist erlaubt, aber sie durchsuchen oft die Zelle und sie nehmen dies alles weg. Sie kontrollieren es und nach einiger Zeit geben sie uns das, was sie noch für zulässig halten, zurück. Man nimmt es wieder und es ekelt einen an. Diese Methode ist ein teuflischer Versuch, einen zu vernichten, als Menschen zu erniedrigen. Sie wollen dich zwingen, selbst die Zensur deiner Gedanken zu übernehmen, sie selbst für sie präsentabel zu gestalten. Das heißt, du sollst deine eigenen Gedanken mit ihren Augen sehen, du selbst sie aus ihrer Perspektive heraus kontrollieren. Es ist, als würden sie dir einen Nagel ins Hirn hämmern, der es aus den Fugen hebt. Bei dieser ihrer Methode, Risse zu schlagen und den Menschen zu spalten, gibt es zwei Wege sich zu wehren: Wir lassen sie einige unserer Aufzeichnungen, in welchen unsere Position eindeutig steht, finden und mitnehmen. Damit provozieren wir sie. Wir fühlen sogar eine kindliche Befriedigung, wenn wir uns vorstellen, was für ein Gesicht sie bei der Lektüre machen. Andere Texte, die wir für uns behalten wollen, verstecken wir. Die Phantasie des Gefangenen beim Finden von Verstecken ist unvorstellbar. Diese sind meistens klein. So muss das Geschriebene geringfügig sein. Jedes Wort zählt, ist wertvoll. Wenn ein Versteck sich als sicher erweist, ist man sehr froh. Man hat ein seltsames Gefühl des Stolzes, als hätte man die Ehre des Menschen verteidigt. Darin liegt die Bedeutung unserer Schriften.
In der Zelle holt der Verstand häufig die Toten zu sich. Im leeren Raum hat nur das Erdachte Bestand. Meine Zelle ist ein Loch ohne Boden im leeren Raum. Am häufigsten, fast jeden Tag, besucht mich Jannis, mein Bruder. Er ist im Krieg umgekommen. Nicht indem er selbst auch andere tötete. Er war Arzt. In seinem Bataillon grassierte die Meningitis. Sich selbst Heilung zu verschaffen, gelang ihm nicht mehr. Nie habe ich seinen Tod verwinden können. Nur mit der Zeit konnte ich seine Abwesenheit hinnehmen. Jetzt sind wir wieder sehr oft zusammen. Er kommt und breitet die tiefe Güte seines Wesens aus. Er hat tief honigfarbene, lächelnde Augen. Er sitzt stundenlang da und wir denken gemeinsam. Auch damals, als er am Leben war, war es so. Jetzt bringt er mich oft dazu, zu denken, dass der Wert der Güte nicht in Zweifel gezogen werden kann. Dieser jedenfalls nicht. Vor allem jetzt, wo ich die Folterer, die Wächter und ihre Handlanger aus nächster Nähe kennengelernt habe. Jetzt weiß ich, wie sie in der Bestialität ihrer totalen Macht zum tiefsten Elend herabsinken. Es ist offensichtlich so, dass alles bei der Güte beginnt. Jannis ist fest davon überzeugt. Auch der Mut und auch die Liebe für gewisse Sinngebungen und Bedeutungen, die den Menschen betreffen, auch das Bewegtsein durch die Schönheit. Alles fängt bei der Güte an. Auch die Spontanität der Erhebung. Manchmal steht er auf und macht an meiner Stelle die drei Schritte vor, drei zurück. Ich betrachte ihn, seine kräftige Statur. Früher mochte er gerne segeln. Während er hin- und hergeht, bringt er das Meer und den Wind in diesen ebenen Raum. Und verleiht ihm, so wie er den Arm hebt, sogar wieder eine Dimension der Tiefe, auf die wir beide hinzielen. Dann fängt er offenbar an, in Musik zu denken. Er liebte sie sehr. So füllt sich die Zelle langsam mit Musik. Und ich gehe in langen Stunden der Nacht mit ihr zusammen auf die Reise. Das sind meine ruhigen Nächte, Nächte, in denen ich mich seiner Erklärung der Welt annähere. Wenn er tot ist, dann bin ich es auch. Ich glaube, wir leben weiter.
Manchmal versuche ich meine Beweggründe, die mich bis in das Gefängnis gebracht haben und mich befähigen, die Haft auszuhalten, zusammenzufassen. Die Motivierung liegt sicherlich nicht in der Gewissheit irgendeiner Wahrheit. Keineswegs aber, weil wir nicht mehr im Besitz von Wahrheiten sind, sondern weil in unserer Welt deren Gewissheit nicht ausreicht. Wir sind nicht mehr so leicht zufriedenzustellen, wir verlangen etwas mehr als eine Gewissheit, etwas Substanzielleres, zugleich Ursprüngliches und Einfaches. Meine Motive können insgesamt eher als eine Hoffnung betrachtet werden: zerbrechlich, spontan und unbesiegbar wie kein anderer Bereich des menschlichen Intellekts. Tiefverwurzelt, ungeschützt hat eine Hoffnung mir den Weg gezeichnet, der mich bis in die Wüste des Gefängnisses gebracht hat, ohne Reue, und mich die Haft ertragen lässt, wie jene kleinen Pflanzen, die auch mitten in der Wüste ganz aus sich noch den einen unerklärlichen Tropfen Flüssigkeit selbst hervorbringen, der sie am Leben erhält; ein solcher Tropfen ist meine Hoffnung. Sie in Worte zu fassen ist schwer, so stark dieses Gefühl auch sein mag. Ich könnte es vielleicht so ausdrücken: Es ist die Hoffnung auf die Menschenwürde, die nicht verloren gehen kann, mag sie auch von überall bedroht sein; wir wissen, gerade deshalb, dass es nichts Ernsteres und Wichtigeres im Leben gibt, als sie zu verteidigen auch um den Preis unausweichlichen Leidens. So ausgedrückt klingt das alles freilich zu abstrakt: Diese Hoffnung nimmt nur dann wirklich Gestalt an, wenn sie zu einem Verhalten wird, zu einer Haltung. Ich bin dieser Haltung immer wieder begegnet, während jener Zeit, die ich in den verschiedenen Haftanstalten verbrachte.
Ich erinnere mich an das Mädchen in der Nachbarzelle des Polizeigefängnisses. Sie war schon fünf Monate in Untersuchungshaft. Während dieser ganzen Zeit hat sie das Tageslicht nie erblickt. Man hatte sie angeklagt, ihrem Verlobten beim Widerstand geholfen zu haben. Sie wurde ununterbrochen verhört; mal durch Gewaltanwendung, mal durch List wollte man sie dazu bringen, ihren Verlobten zu verleugnen. Sie wäre dann freigelassen worden. Standhaft weigerte sie sich bis ans Ende, obwohl sie wusste, dass ihr Verlobter, der krebskrank war, bald sterben würde, sie ihn also nicht mehr sehen würde. Am Tage ihres Prozesses ist er gestorben, so hat sie ihn in der Tat nicht mehr gesehen. Sie war ein zartes, blasses Mädchen, ein edles Geschöpf. Mit leiser, weicher Stimme sang sie in ihrer Zelle, manchmal die ganze Nacht, sang traurig bis zum Morgengrauen von ihrer Liebe. Das Verhalten dieses Mädchens ist meine Hoffnung.
Auch die Haltung jenes schuldlosen Arztes, den man in unseren Prozess verwickelt hatte. Da sie über kein Belastungsmaterial gegen ihn verfügten, wäre er freigesprochen worden, wenn er vor dem Militärgericht eine auch nur einigermaßen neutrale Position eingenommen hätte. Doch er war ein Mann von hohem Sinn, das lag in seinem Blut. Und er begehrte auf. Vor dem Richter sprach er aufrecht von der Freiheit. Er verteidigte sie, obwohl er Frau und Kind zu ernähren hatte. Man verurteilte ihn zu sieben Jahren Kerker.* Das Verhalten dieses Arztes ist meine Hoffnung.
Ich habe eine ganze Reihe solcher Begebenheiten miterlebt. Ich will damit Folgendes sagen: Was in diesen Verhaltensweisen dominiert, ist die Spontaneität des Bewusstseins davon, dass die Erhaltung der eigenen Menschenwürde lohnender ist als alles andere. Nicht den Barbaren gehört das Leben, mögen sie auch die absolute Macht besitzen. Diesem Bewusstsein entspringt die Hoffnung, die mich beherrscht, die mich trägt.
Ich lebe mit einigen mir teuren Ideen. Sie erfüllen meine Tage und meine Nächte. Der tückischen Monotonie meiner wie reglos vorbeiziehenden Stunden setze ich das Zwiegespräch mit ihnen entgegen. Nunmehr kenne ich sie noch besser, es ist mir noch leichter sie zu akzeptieren. Denn jetzt habe ich ihre Bedeutung in der Wirklichkeit erlebt. Als man mich durch die Verhöre zog, erkannte ich das tiefste und zugleich einfachste Wesen der Würde. Vor dem Militärgericht spürte ich den Hunger nach Gerechtigkeit, im Gefängnis den Durst nach Menschlichkeit. Die Gewalt, die mein Land würgt, hat mich vieles gelehrt. Unter anderem auch den Wert der Unnachgiebigkeit.
Heute sitze ich hier, denke über all das nach und werde von einer eigenartigen Kraft erfüllt. Sie hat nichts gemeinsam mit der Macht meiner Wächter. Sie äußert sich nicht in Geschrei und Dreistigkeit. Sie ist die Kraft der Geduld. Die Kraft der Überzeugung, dass man sich im Recht befindet. Darum bin ich imstande, gegen die unaufhörlich gegen mich entfesselte Offensive der leeren Tage zu kämpfen. Ich wehre sie stets ganz am Anfang ab. Zur Stunde der Dämmerung, kurz vor dem Sonnenaufgang: Dann spreche ich laut das Wort »Freiheit«. Immer wieder steige ich aus dem Schlaf mit der überraschenden, bitteren Erkenntnis, mich im Gefängnis zu befinden. Genau dann spreche ich aus das geliebte Wort. Bevor ich vom Bewusstsein der Haft überwältigt werde. Indem ich dieses Wort ausspreche, zieht die Idee in meine Zelle ein. Es ist ein Zauberwort, das mich mit meinem neuen leeren Tag versöhnt.
Ich denke an meine Gefährten. An die politischen Gefangenen, denen ich in den verschiedenen Haftanstalten begegnet bin. An alle die, die sich nicht gebeugt haben und die jetzt mit kleinen nervösen Schritten, drei vor, drei zurück, in ihren Zellen, ihrem Golgatha, gehen. Sie alle sind, trotz aller Verschiedenheit, grundsätzlich von der gleichen seelischen Beschaffenheit. Sie alle besitzen jene seltene, überwache Sensibilität des Gewissens. Eine ungemein große Sensibilität, die sich in den kleinsten und in großen Dingen äußert. Sie sprechen und achten darauf, die Seele des anderen nicht aufzuwühlen. Sie reichen dir das Glas Wasser, bevor du es verlangst hast. Hier ein Beispiel dieser Empfindsamkeit: Vor einigen Tagen sollte einer von uns entlassen werden. Er war im Gefängniskrankenhaus. Er konnte von dort aus weggehen. Doch er verzögerte selbst seine Entlassung um eine ganze Woche, um sich erst von uns zu verabschieden. Sieben Tage freiwilliger Haft, um seinen Genossen die Hand zu drücken. Das ist es. Sie haben wirklich das ganze Problem des Menschen auf sich genommen.
Sie alle tragen wissentlich die ganze Last unseres erniedrigten Volkes, verbunden mit allen Verfolgten dieser Welt. So wird der Sinn von jedem Ereignis in der Welt einheitlich erfasst, in einem Grundsatz, der dem Wunsch des Menschen entspringt, jeder Unterdrückung zu entgehen. Wer, wo immer auf der Welt, Widerstand leistet, ist ihr Bruder. Vor einiger Zeit hatte man in unser Gefängnis zwei palästinensischen Rebellen gebracht. Vom ersten Tag an wurden die Gefangenen mit ihnen eins. Und sie waren es wirklich. Alle die, die es als ihre eigene Pflicht ansehen, die Unterdrückung zu bekämpfen, stehen auf der gleichen Seite, und sie gehörten zu ihnen. Empfänglichkeit für das tragische Spiel der Welt ist nicht nur eine ihnen gemeinsame Eigenschaft, sie kommt beinah einer gemeinsamen Herkunft gleich. Mit solchen Menschen sind die Gefängnisse in meinem Land und in anderen Ländern gefüllt.
Oft frage ich mich, was es gewesen sein mag, das unser Gewissen erschüttert hat, und zwar in einem solchen Ausmaß, dass jeder von uns eine persönliche Motivierung fand, gegen die Diktatur aufzustehen und in den Widerstand zu treten, alle privaten Verpflichtungen und Ambitionen beiseite schiebend. Ohne einen tieferen persönlichen Grund nimmt man nicht am Widerstand Teil, an diesem gefährlichen Kampf mit der mächtigen Verfolgungsmaschinerie der Diktatur, bei dem die Wahrscheinlichkeit, verhaftet zu werden, viel größer ist als die zu entkommen, und wo die Verhaftung unerträgliche und langwierige Qual impliziert. Ohne einen Grund, der bis ins Tiefste deiner Menschlichkeit reicht, würdest du dich nicht entschlossen haben, dich zu exponieren, um mit hoher Wahrscheinlichkeit in die Hände der Willkür und der Barbarei zu fallen, von einem Menschen zu einem Objekt ihrer Gewalt zu werden, ausgeliefert unerträglichen Qualen; ohne besonderen Grund würdest du nicht alles, was du erreicht hast und alles, wovon du geträumt hast, aufgeben und geliebte Menschen in schreckliche Angst, Verfolgung und Entbehrung stürzen. Ich meine, der Grund dieses Entschlusses kann nichts anderes gewesen sein, als die Erniedrigung, die die Diktatur für dich als Individuum und für das Volk, dem du angehörst, bedeutet. Denn das empfindest du vom ersten Augenblick der Auferlegung der Diktatur an: Erniedrigung. Auf eine ganz unmittelbare Art, ohne dass es einer zusätzlichen intellektuellen Verarbeitung bedürfte.
Denn mit der Errichtung der Diktatur ist einem das Recht entzogen worden, die Verantwortung für das eigene Leben und Schicksal zu tragen. Dieses Gefühl der Erniedrigung wächst von Tag zu Tag und zwar durch deren Methode, deinen Verstand dahingehend zu manipulieren, dass du all die Gemeinheiten erträgst, aus welchen der monströse Geist der Diktatoren besteht. Du spürst, wie sie dich tief in deinem Denken und in deine menschliche Beschaffenheit hinein tagtäglich beleidigen. Hinzu kommt die auferlegte Duldung ihrer barbarischen Taten, zu der sie dich durch die Angst zwingen. Die Erniedrigung durch die Angst wird zum Alltag, allmählich widerst du dich selbst an. Dann kommt aber der Augenblick, in dem du, in deiner Menschlichkeit versehrt, die Solidarität mit deinem Volk verspürst, dich auf direkte Weise mit ihm verbunden fühlst, dich mitverantwortlich für sein weiteres Schicksal weißt. Diese Identifizierung verschafft deinem Blick eine dir noch unbekannte Schärfe für die Geschichte. Jetzt siehst du es deutlich: Die erniedrigten Völker werden unabdingbar entweder in die tödliche Dekadenz der geistigen Lähmung und der moralischen Verunsicherung geführt, oder aber zur Rache angetrieben, die in Blutvergießen mündet. Erniedrigte Völker rächen sich oder sterben den geistigen und moralischen Tod. Durch dieses Begreifen der unaufhaltsamen Zerstörung deines Volkes verwandelt sich deine persönliche Erniedrigung in Pflichtbewusstsein, und so gehörst du nicht einfach dem Widerstand an, sondern du leistest ihn. Das bedeutet, du setzt den Sinn deines Daseins in die Durchführung jenes paradoxen, gefährlichsten und uneigennützigsten Kampfes, der Widerstand heißt. Von nun an »helfe dir Gott«…
Der Widerstand ist, moralisch gesehen, der reinste Kampf. Denn in der Regel wird er allein auf Grund eines Gewissensimperativs aufgenommen und verschafft keine andere Befriedigung als die Rechtfertigung dieses Gewissens. Nicht nur erwartet man daraus keinen Nutzen, man setzt vielmehr alles auf eine beinah sichere Zerstörung von all dem, was man bisher mühevoll erbaut hat und begibt sich in ein Leben voller Angst und Gefahren. Insgeheim und im Dunkel agierend, kann man nicht mit dem Lob der Gegenwart rechnen, auch nicht mit dem morgigen, da die Zukunft in Diktaturen stets ungewiss bleibt. Rechtfertigung liegt ausschließlich im eigenen Gewissen, sowie man sie manchmal in den Augen eines Gefährten sich spiegeln sieht. Aber diese Bestätigung im Recht zählt mehr als alles andere. Wenn einem einige Stunden geschenkt werden, in denen man spüren kann, man ist selbst Ausdruck menschlicher Würde, das ist die stärkste Erfahrung, die stärkste Rechtfertigung. Deshalb ist der Widerstand der würdigste Kampf, den man führen kann, die dramatischte Bestätigung eines gewissenhaften Menschen. Genau das ist es.
Viele verstehen uns nicht. Es ist, wie es scheint, auch schwierig, Handlungen zu verstehen, deren einziges Motiv ein Gewissensimperativ ist, darüber hinaus eine Erfahrung, die zu Grenzsituationen führt. Wir haben gehandelt in der Ausschließlichkeit dieses Gebots, und das brachte jeden von uns in eine Grenzsituation. Wie sollen wir leicht verstanden werden? Wir leben nunmehr nur im Bezug auf Werte, nicht im Bezug auf Interessen. Wir haben uns freiwillig in den Bereich unerträglichen Leids begeben, und unsere tägliche große Sorge ist nicht nur unsere Menschlichkeit mitten in diesem Leid aufrechtzuerhalten, sondern das Leid in unser Menschsein einzuordnen, es einem seiner konstitutiven Bestandteile umzuwandeln. Wir erbauen aus der Qual und auf ihr ein Dasein, das freilich nicht aus anvisierter Freude und Glück besteht, sondern nur aus Sinngebungen. Wir sind fleischgewordene Sinngebungen. Wir leben nicht im Heute. Wir haben ja auch keinen Tag, der ein Heute wäre, außer den Tag des Besuchs unserer Angehörigen. Dann, ja, in den zehn Minuten der Besuchszeit, fühlen wir wieder das Glück und den Schmerz, der von den anderen Menschen und ihrer Liebe auf uns ausstrahlt. Wir bekommen wieder menschliche Interessen, das Bedürfnis nach Freude, den Abscheu vor Schmerz. Zehn Minuten lang haben wir ein Heute.
Sonst leben wir außerhalb der Zeit. Denn wir existieren nur durch die Rechtfertigung unseres Gewissens und nur für sie. Wir sind ohne Zeit. In diesem Sinne würden wir den Stand des Absoluten erreichen, wenn wir nicht tagtäglich in uns selbst diese Bestätigung im Recht aufs Neue erkämpfen müssten. Denn dieser unser Stand, diese Fleischwerdung von Sinngebungen ist alles andere als statisch. Wir haben ein Blut, das fordert, wir haben ein Herz, das träumt, und ein Gedächtnis, das vergangenes Glück wiederkäut. Wir haben unsere Liebe für bestimmte, uns gehörende Menschen. Darin liegt eine Bedrohung. So ringen wir ununterbrochen mit uns selbst, um nur eine Sinngebung zu bleiben. Fest zu beharren auf dieser zitternden Magnetnadel des Gewissens. Wegen dieser Mühewaltung sind wir keine absoluten Wesen. Ihr verdanken wir es, dass wir noch keine Toten sind.
Wir fühlen uns stark als Europäer. Dieses Gefühl hat seinen Ursprung nicht nur in einer politischen Überzeugung, mag sie auch eine Grundhaltung sein, sondern vielmehr in der Unmittelbarkeit, mit der bestimme kulturelle Inhalte und Erfahrungen durch die Diktatur wieder an Bedeutung gewinnen. Das heißt, dass die Werte, deren Relevanz wir gerade in Griechenland heute so intensiv erleben und die uns befähigen, unsere Tage und Nächte hier zu ertragen, glücklicherweise nicht nur unsere sind. Wir teilen sie mit dem Volk von Europa, ja diesem einen Volk von Europa.
Wir hier können aus dem Gefängnis in vollem Ernst diesen Begriff gebrauchen. Wir können es einfach sagen, denn das Leiden schärft unseren Blick für die Substanz der Dinge, wir sehen den Sinn und nicht die unsinnigen Grenzen, die kleinlichen Rivalitäten und die nunmehr grundlosen Vorbehalte. Wir sehen einfach dieses Volk als unser einziges Ich. Zunächst mutet es paradox an, aber die Griechen haben sich vom ersten Augenblick der Diktatur an intensiv als Europäer gefühlt. Durch die Erniedrigung wird man der verletzten Werte stärker gewahr. Und unsere Werte sind die Werte Europas. Wir alle zusammen haben sie geschaffen. Wir Griechen haben von Anfang an gewusst, dass niemand die Tragödie, die sich in unserem Land abzuspielen begann, so begreifen würde wie eben die Menschen in Europa. Und so ist es auch gewesen. Unser verzweifelter Blick richtete sich auf das Volk von Europa, und seine Menschen haben uns nicht im Stich gelassen. Wir alle, die den qualvollen Weg der Gefangenschaft in den Haftanstalten der Diktatur gehen mussten, sagen heute »Europa« und meinen »Heimat«.
Wir meinen ganz genau jenes eng geknüpfte Gebilde aus historischen Erfahrungen, kulturellen Sinngebungen und menschlicher Solidarität, das wir »Heimat« nennen. Wir umklammern die Gitterstäbe unserer kleinen Fenster, sehen nach draußen und denken an die anderen Menschen, diese Tausende von Menschen, die auf den Straßen gehen, die uns, würden sie uns sehen können, zuwinken würden. Unser Blick umfasst ganz Europa. Denn dort sind überall Menschen an unserer Seite, Menschen, die uns zuwinken würden.
Die Kopfjäger haben uns in diesem engen Raum eingesperrt, damit wir austrocknen und schrumpfen, wie jene schauderhaften Menschenköpfe, ihre Trophäen. Dafür aber hat sich unser Land ausgeweitet, ist zu einem Kontinent geworden. Sie halten uns in der Isolation, damit wir vereinsamen, verloren und einsam in einem gänzlich individuellen Dasein. Wir aber werden von der großen europäischen Solidarität getragen. Die Gewalt der Kopfjäger ist vor unserem gemeinsamen Sinn machtlos.
Man spricht von der Würde des Menschen. Ich habe sie erlebt. Es gibt sie tatsächlich. Wie eine hochempfindliche Stahlfeder im Inneren des Individuums. Sie hat mit der sogenannten persönlichen Würde nichts zu tun, ihre Wurzeln sitzen viel tiefer. In der Hölle der Verhöre verlor ich meine persönliche Würde. An ihrer Stelle gab es so viel Schmerz. Aber ohne dass ich es wusste, lebte in mir die Menschenwürde fort. An einem bestimmten Zeitpunkt haben sie sie getroffen. An einem fortgeschrittenen Zeitpunkt des Verhörs. Sie kennen sie nicht und so sind sie nicht in der Lage auszurechnen, wann genau sie berührt wird und in Funktion tritt. Sie funktionierte wie eine Feder, die meine auseinanderfallende Seele wieder emporhob. Nicht ich war es, der sich erhob, sondern irgendjemand von der Gattung, der ich angehöre, und dessen wichtigstes, gemeinsames Band diese seine Würde ist. Sie verhindert, dass wir zu vereinsamten Wesen werden: Wir gehören einem empfindsamen Geschlecht an. Vom Augenblick an, an dem ich diese Sensibilität zu spüren begann, war ich dem Verhör gewachsen. Ich habe es nicht für mich allein versucht, sondern für alle. Zusammen haben wir ausgehalten.
Ich habe das Schicksal des Opfers erlebt, und so habe ich das Gesicht des Folterers aus nächster Nähe betrachten können. Seins war erschreckender als mein blasses, blutendes Gesicht. Seins war nicht auf menschliche Art verzerrt. Die Erregung verlieh ihm – das ist keine Übertreibung – den Ausdruck bestimmter chinesischer Masken. Foltern ist keine leichte Sache. Es verlangt innere Anteilnahme. Ich hatte also eigentlich Glück. Ich war nicht derjenige, der jemanden erniedrigte. Ich trug nur in meinem schmerzenden Inneren den sehr unglücklichen Menschen. Sie aber müssen, um dich zu erniedrigen, erst in sich selbst den Menschen erniedrigen. Mögen sie auch aufgeblasen in ihrer Uniform herumlaufen, Herren über den körperlichen Schmerz, die Schlaflosigkeit, den Hunger und die Verzweiflung ihres Mitmenschen. Machttrunken. Ihre Trunkenheit ist die tiefste aller Demütigungen. Um das durchzuführen, was sie gegen mich durchgeführt haben, haben sie erst den Menschen in sich selbst vernichten müssen. Sie haben mein Martyrium teuer bezahlt. Nicht ich war in der schlechteren Lage. Ich war nur der Gepeinigte, der keuchte. Mir war das lieber. Jetzt kann ich zwar nicht mehr die Kinder spielen und zur Schule gehen sehen. Sie aber, wie können sie ihren Kindern ins Gesicht blicken? Ihre Erniedrigung ist genau das, was ich dem Diktator nicht verzeihen kann.
Unter meinen wenigen Habseligkeiten befindet sich ein Bild des Erasmus, ein Zeitungsausschnitt. Ich hatte es mal ausgeschnitten. Jetzt betrachte ich es oft und eine gewisse Ruhe kehrt in mir ein. Das lässt sich sicherlich erklären. Das beschäftigt mich aber nicht. Mir genügt der Zauber. Diese seltsame Erhabenheit, seine mit unseren Sinngebungen identische Gestalt. Die Aufhebung meiner Einsamkeit, die vor so vielen Jahrhunderten ansetzte und die ich beim Anblick seines Gesichts spüre. Er ist im Profil abgebildet und das gefällt mir. Er sieht mich nicht an, er zeigt, wohin ich meinen Blick richten soll. Er verrät mir die Solidarität des Blicks. Das Bedürfnis nach dieser Solidarität ist im Gefängnis so groß wie das tägliche Bedürfnis nach Wasser, nach Brot, nach Schlaf. Bei ihren Durchsuchungen finden sie stets das Bild des Erasmus, aber keiner nimmt es mir weg. Sie verstehen nicht. Sie wissen nicht, wie gefährlich die Weisen ohne Arg sind. Ich frage mich manchmal, das Auge des Wächters im Guckloch meiner Tür, wo findet dieses Auge die Solidarität des Blicks?
Unsere Lage hat viele Merkmale. Eins davon ist, dass wir singen. Das klingt merkwürdig für diejenigen, die von Gefängnissen nichts wissen. Aber es ist so, und es ist ganz natürlich. Das wird auch durch die ungeschriebenen Anordnungen bestätigt, die die älteren Insassen den neuen zukommen lassen: Wenn dir traurig zumute ist, wenn Klage dich erstickt, dann singe. Genau das, wir singen, wenn Verzweiflung und Angst uns zu übermannen drohen. An weniger schlimmen Tagen singen wir nicht. Beim Singen schmilzt diese Angst, die sich nicht mehr ertragen lässt, zusammen, sie löst sich von einem wie ein unsichtbarer, grauer Dunst. Das wissen sie. Und so ist in einigen Haftanstalten, den härtesten, das Singen verboten. Ich singe, oder ich pfeife. Ab und zu singe ich für meine Frau. Würde sie mich hören, würde es ihr gefallen, obwohl ich nur falsch singen kann. Auch sie kennt sich aus im Gefängnis-Singen. Sie hat es erlebt. Hier ist das Singen ein wirklich unumgängliches Bedürfnis der Seele. So etwas wie das tägliche Brot derer, die darum kämpfen, nicht den Verstand zu verlieren.
Die Welt wird milder, weitet sich aus in erlösende Ferne, auf deren Wellen du getragen wirst. Ich muss es sagen: Ich bin denen, die diese Lieder geschrieben haben, dankbar. Vor allem denen, die traurige, schmerzerfüllte Lieder geschrieben haben. Ich singe gerne Lieder von Theodorakis. Auch in einigen seiner älteren ist die Vorahnung der Haft, die er erleben sollte. Wir singen also. Das ist ein zu berücksichtigendes Merkmal unserer Lage.
Meine Wächter habe ich nie singen hören. Meistens sind sie mit dem Verdauen beschäftigt.
Wir sitzen alle, einzeln eingesperrt, in unseren Zellen. Äußerlich gesehen sind wir die ohnmächtigsten Kreaturen. Sie können mit uns machen, was sie wollen. Man sitzt da, sie kommen und nehmen einen mit, bringen ihn wer weiß wohin, in ein anderes Gefängnis. Hätten sie nicht so viel Angst vor uns, so würde ich sagen, wir seien für sie wie leblose Gegenstände. Doch ihre Angst vor uns rettet unsere Menschensubstanz. Auch in ihren Augen. Wir ohnmächtigen Kreaturen also haben gar nichts anderes zu tun, als über das Schicksal der Welt nachzudenken. Wenn sie uns aus unseren Zellen holen und wir uns begegnen, sprechen wir nur davon. Nur das ist unsere Sorge. Wir teilen mit so vielen anderen das Wissen um die Bedeutung der Liebe für die Freiheit, die in der Welt erzittert. Und wir sehen nunmehr deutlich ihre Feinde. Wir bangen um das Schicksal unseres Landes, das wir Europa nennen. Denn an Europa hängen alle Hoffnungen, und gerade deshalb wird es immer wieder bedroht. Es ist sehr gefährlich, Träger von menschlichen Hoffnungen zu sein. Welchen Sinn hätte sonst die Versklavung von Griechenland? Sie haben einen Brückenkopf gebaut; einen Brückenkopf neben den spanischen und den portugiesischen. Sie haben Angst vor Europa, vor dem Europa, das wie eine ewige Quelle Ideen gebiert. In seinem uralten Erdreich liegt immer noch der Samen verborgen. Einfache Menschen bringen ihn zur Blüte, mit dieser in dieser Region der Erde so selbstverständlichen Unruhe des Geistes. Die anderen, die sogenannten Überreichen, die Überbewaffneten, haben Recht, Europa zu fürchten. Wenn wir, in Europa, vom Menschen sprechen, verstehen wir den Sinn des Menschen: Maß aller Dinge zu sein. Das ist unser ältester, weisester und explosivster Gedanke. Wegen dieses Gedankens fürchten sie Europa. Sie wissen, dass es unvermeidlich eines Tages seine Rolle spielen wird. Darum richtet sich heute unsere ganze Sorge auf dieses Europa. Von uns, den ohnmächtigsten aller Wesen.
Ich weiß nun genau Bescheid. Es war nichts anderes möglich: Mein Eintritt in den Widerstand war unvermeidlich von dem Augenblick an, da mein Land gedemütigt worden ist. Es war eine unausweichliche seelische Finalität. Mein ganzes Leben führte dahin. Als Kind hatte ich gelernt, meinen Blick auf den offenen Horizont zu richten, das Gesicht des Menschen zu lieben und die Freiheit zu achten. Als junger Mann gehörte ich, während des großen Krieges, zum Widerstand. Er hat mich moralisch geformt. Er drückte mir seinen Stempel auf. Nur wusste ich in den Jahren danach nicht, wie tief sich mir dieses Zeichen eingeprägt hatte. Der Widerstand erwies sich als der vitale Mythos meines Lebens. Was sich bisher ereignet hat, wird jetzt auf die Waage gestellt. Als sie die Diktatur errichteten, gehörte ich, ohne es zu wissen, bereits dem Widerstand an. Ich trug mein Schicksal schon in mir. Nichts ist Zufall gewesen. Zufällig waren nur die Einzelheiten der Ereignisse – sie allerdings in teuflischer Verstrickung. Doch den Weg, den kannte ich, er war in mir. So wie ich immer an dem Wort hing «Freiheit, meine Geliebte«. Es ist kein Irrtum, dass ich mich im Gefängnis befinde. Ich gehöre hierher. Der schreckliche Irrtum ist, dass es dieses Gefängnis gibt.
Ich muss von einer Freundschaft vom vergangenen Herbst sprechen. Das ist insofern von einer gewissen Bedeutung, als es von der Solidarität zeugt, die zwischen den Unglücklichen entsteht. Damals wurde ich für vier Monate in totaler Isolation gehalten. Ich hatte kein einziges menschliches Wesen gesehen. Nur Uniformen, Wächter und die mich Verhörenden. In meiner Zelle fielen mir einmal drei Mücken auf. Sie kämpften ums Überleben wegen der einsetzenden Kälte. Tagsüber schliefen sie an der Wand. Abends kamen sie pfeifend zu mir. Am Anfang habe ich es als störend empfunden. Glücklicherweise aber habe ich es bald begriffen. Wie sie, so versuchte auch ich gegen die Kälte anzugehen. Was verlangten sie von mir? Etwas Bedeutungsloses. Einen rettenden Tropfen Blut. Man konnte ihn ihnen nicht verweigern. Abends entblößte ich meinen Arm und wartete. Mit der Zeit hatten sie mich kennengelernt und hatten keine Angst vor mir. Sie kamen ohne Bedenken zu mir. Ich bin ihnen für diese Bedenkenlosigkeit dankbar. Derentwegen war die Welt nicht nur ein Verhör. Eines Tages aber wurde ich woanders hingebracht und habe sie seitdem nie wiedergesehen. Auf solch eine willkürliche Weise büßt man in der Gefangenschaft die Anwesenheit von Freunden ein.
Es waren jene Monate, in welchen ich in die Maschinerie des Verhörs verwickelt war, allein gegenüber den Leuten mit den vielen Augen der Spinne und den gleichen Gefühlsregungen, als einmal nachts der wachhabende Polizist mir zulächelte. In jenem Augenblick war dieser Mensch für mich alle Menschen. Als man mich dann eines Tages endlich zu einem anderen Gefangenen in die Zelle brachte und dieser anfing mir von der Leidenschaft seines Lebens, Booten und Kutter, zu erzählen, da war auch dieser eine für mich alle Menschen. Es trifft also zu, dass es Situationen gibt, in denen jeder Einzelne von uns stellvertretend für die Menschheit da ist. So auch jetzt. Ich gebe meine Papiere einem unglücklichen Italiener, der aber jetzt freigelassen wird und sich einverstanden erklärt hat, zu versuchen, sie außer Landes zu bringen, dort wo die Freiheit weht. Dieser Mensch ist wieder für mich alle Menschen.
Doch es ist Zeit dies hier zu beenden. Mein Winkzeichen ist schon gegeben. Auf diese Weise existieren wir, glücklicherweise, alle. Wir, die im Gefängnis sind, und ihr im Einverständnis mit uns.
»Also Freiheit, meine Geliebte.«
* Gemeint ist Ioannis A. Papadopoulos, Autor vom Brief an den Sohn, in: Die Exekution des Mythos, S. 327.
Freiheit, meine Geliebte [Ελευθερία, αγάπη μου]
Aus dem Griechischen übersetzt von Danae Coulmas und Nonna Nielsen-Stokkeby. Der Text von Giorgos Alexandros Mangakis erscheint in der Anthologie mit freundlicher Genehmigung des Nomos-Verlags.
Auszug aus: Danae Coulmas (Hg.), Die Exekution des Mythos. Eine Anthologie mit Texten des Widerstands aus der Zeit der griechischen Militärdiktatur 1967–1974, Berlin, Edition Romiosini, 2017, S. 263-283.
© 2017 Edition Romiosini, Freie Universität Berlin. Alle Rechte vorbehalten.